Die St. Michaelskirche Schwanberg
„Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein.“ (Offenbarung 21)
Diese Worte aus der Offenbarung des Johannes prägen die Geschichte der Communität Casteller Ring seit ihren Anfängen im Jahr 1950. In der am 24. Mai 1987 eingeweihten St. Michaelskirche haben sie auf dem Schwanberg baulich Gestalt angenommen. Der Architekt, Alexander Freiherr von Branca, verwirklichte in diesem Sakralbau die Gleichzeitigkeit von weltoffener Weite und konzentrierter Sammlung. Sie ist die einzige Kirche, in der Alexander Freiherr von Branca seinen Wunsch verwirklichen konnte, den Altar in die Mitte zu setzen. Dies entsprach freilich auch unserem eigenen Wunsch.
Die Kirche bildet den architektonischen und geistlichen Mittelpunkt des Schwanbergs. Ihre Mitte ist der von acht Engeln getragene Altar – ein Ort des Innehaltens und der Sammlung in aller Bewegung des Lebens.
Die schwere Granitplatte des Altares wurde im Steinbruch Flossenbürg gebrochen, wo in den Jahren der Hitlerdiktatur Tausende im KZ ums Leben kamen (u.a. Dietrich Bonhoeffer). In der Eucharistie trägt der Altar Brot und Wein, die sichtbaren Zeichen der verborgenen Gegenwart Gottes. So begegnet uns Gott in unseren menschlichen Abgründen und ist uns gerade in Schuld und Verfehlung ganz nah.
Auf dem Pilgerweg des Glaubens in Geschichte, Gegenwart und Zukunft bereitet die Kirche allen Menschen einen Rastplatz, die gemeinsam unterwegs zum Himmlischen Jerusalem sind.
„Mi-ka-el“ – Wer ist wie Gott!? So tönt der hebräische Name der Kirche. Der Ruf lädt ein zur Feier des Sakraments, zum Singen der Psalmen, zum Hören auf Gottes Wort zum Dienst der Anbetung und Verherrlichung Gottes, zur Fürbitte oder einfach zum stillen Verweilen in Seiner Gegenwart.
Wollen Sie sich in der Kirche umsehen? Thomas Schwarz hat 360°-Panoramen erstellt: St. Michaelskirche.
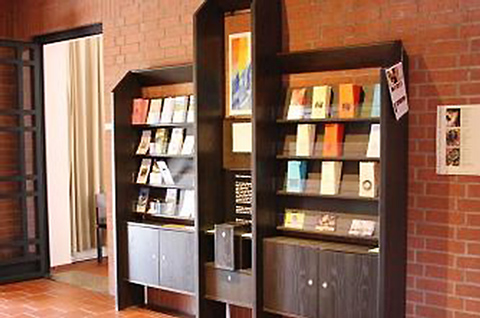
Fürbitten
Die Fürbitte ist uns ein tägliches Anliegen. Gerne können Sie uns ihr Bitten nennen: Im Vorraum der Kirche befindet sich ein Fürbittkasten, dem Sie ihre ganz persönliche Gebetsanliegen anvertrauen können.
Auf der Seite der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern befindet sich eine digitale Gebetszettelwand, die jedem frei zur Verfügung steht.
Rundgang durch die St. Michaelskirche

Stein aus der alten Kapelle
Namenspatron der Kirche ist der Erzengel Michael. Schon die erste Burgkapelle auf dem Schwanberg war ihm wohl geweiht. Der Erzengel Michael steht für den siegreichen Kampf gegen das Böse. Sein Name ruft uns zu: Wer ist wie Gott?

Brunnen
Der Brunnen als Symbol: Jesus Christus ist die Quelle lebendigen Wassers (Johannes 4,14). In der Kirche werden wir von ihr gestärkt; sie begleitet uns nach draußen, verströmt sich hinein in den Alltag.

Kreis mit zwölf Toren
Die Stadt Gottes, das Neue Jerusalem (Offenbarung 21,10), ist unser Ziel. Ihre Beschreibung in der Offenbarung des Johannes hat die Geschichte der Communität Casteller Ring geprägt, und diese Vision des himmlischen Jerusalem hat die Architektur unserer Kirche inspiriert.

Grundstein
Die St. Michaelskirche wurde unter dem Architekten Alexander Freiherr von Branca, München, in nur einjähriger Bauzeit errichtet. Sie ist die einzige Kirche, in der er seinen Wunsch verwirklichen konnte, den Altar in die Mitte zu setzen. Dies entsprach freilich auch unserem eigenen Wunsch. Sie wurde am 2 Mai 1987 eingeweiht.
Pantokrator-Ikone und Marien-Ikone
Die Christus- und die Marien-Ikone stellen uns bewusst in die Ökumene hinein. Beide Ikonen stammen von einer Nonne aus dem Orden „Congrégation des Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire“ vom Kloster „Monastère des Bénédictines au Mont des Oliviers“ auf dem Ölberg in Jerusalem. Christus wird als segnender Pantokrator (Weltenherrscher) dargestellt – und Maria, wie in der orthodoxen Kirche üblich, nur gemeinsam mit Christus. Sie ist der Mensch, der Gott zur Welt bringt; durch ihre Person gibt sie Gott Gestalt.

Chorgestühl
Wir Schwestern der Communität Casteller Ring beten viermal am Tag das Stundengebet der Kirche. Dem Lob Gottes ist nichts vorzuziehen, sagt der Hl. Benedikt in seiner Ordensregel. Im Geist dieser Regel leben wir als Ordensgemeinschaft in der Evang.-Luth. Kirche. Wir wollen im Leben und Handeln frei sein für Gott und die Menschen.

Altar
Engel, Cheruben, die vor Gottes Thron dienen (Jesaja 6), tragen die 12 Zentner schwere Altarplatte aus Granit. Sie wurde in Flossenbürg gebrochen, dort, wo in der Hitlerdiktatur Tausende getötet wurden. Sie mahnt uns zum christlichen Widerstand gegen Gewaltherrschaft und verbindet uns mit unseren jüdischen Wurzeln und Glaubens-Geschwistern.

Säulen und Baldachin
Die vier Säulen tragen einen überdimensional großen Baldachin. Jüdische Paare heiraten auch heute noch unter dem Baldachin. Die Offenbarung des Johannes vergleicht die Gemeinde mit einer Braut, die ihren himmlischen Bräutigam, Christus, empfängt. So feiern wir unter dem Baldachin in der Eucharistie die Gemeinschaft mit Christus.

Kreuz in der Konche
In den Festzeiten des Kirchenjahres (z.B. Weihnachten, Ostern) steht dort ein glänzendes Kreuz mit einem Christus, der eine Krone trägt. Aufrecht und erhaben ist er dort abgebildet. Engel werden sichtbar. In der Fasten- und Passionszeit tritt an seine Stelle das Passionskreuz. Es hat eine raue Oberfläche. Christus erscheint als Leidender, Zerbrochener. In den nicht geprägten Zeiten des Kirchenjahres steht das Hostienkreuz: Christus, der uns im Alltag begleitet. In allen drei Darstellungen ist Christus in die Welt hineingezeichnet, steht mit ausgebreiteten, segnenden Armen in ihr und bricht die Welt auf.
Erste Seitenkapelle
In diesem Raum findet vor der Pieta das Leid einen Raum. Wie oft, wenn man vom Leid fixiert oder von ihm gefangen ist, übersieht man daneben das Zeichen des Neuen und des Lebens. Rechts neben der Pieta hängt eine Anastasis-Ikone, eine Auferstehungs-Ikone. Sie stellt dar, wie Christus Adam und Eva aus dem Tod befreit.
Raum der Stille
Der Grundriss dieses Raumes hat keinen rechten Winkel. Wenn ein Leben aus dem Lot gekommen ist, findet es hier einen bergenden Raum für das Gebet. Ein Christus-Corpus ist von den Kreuzesbalken gelöst und wirkt jetzt als Segnender. Aus dem Leid wird Segen. Er breitet seine Arme über die Weltkugel aus, auf der es mit jedem Gebet, zu dem eine Kerze angezündet wird, heller wird.

Kreuzgang und Taufbrünnlein
Der Kreuzgang ist offen und geschützt zugleich; ein idealer Ort, um in Ruhe über Gott und die Welt nachzudenken. Der ehemalige Taufstein zeigt, wie Himmel und Erde sich berühren. Wenn der Kreis (Symbol für Gottes Unendlichkeit) und das Quadrat (Symbol für die Erde mit ihren vier Himmelsrichtungen) aufeinander gelegt werden, gibt es acht Schnittpunkte. So ist der Taufstein ein Achteck: Wer getauft wird, bei dem kommt Himmel und Erde zusammen.

Pelikan
Nach einer alten Fabel reißt sich der Pelikan die Seite auf, um seinen Jungen Nahrung zu geben, wenn sie sonst verhungern müssten. Dies steht symbolisch für Christus, der sich für uns hingibt: Er nimmt den Tod auf sich, damit wir befreit von Tod und Todesangst leben können.

Die Friedwaldkapelle
Das farbige Glasfenster und der Altar stammen aus unserer ersten Kapelle in Castell. Die mittelalterliche Schutzmantel-Maria ist eine Leihgabe der St. Jakobskirche, Nürnberg. Die Kapelle ist ein Ort, wo Menschen ihrer Trauer um Verstorbene Ausdruck verleihen können, besonders um die im Friedwald beigesetzten.

Symbol Kreuz und Kreis
Das keltische Kreuz ist zum Zeichen unserer Communität geworden. In diesem Zeichen folgen wir unserer Berufung zum klösterlichen Leben, indem wir Gott suchen, Christus nichts vorziehen und das Leben unter der Führung des Evangeliums gestalten.
Die Außenansicht
Das Dach, der Turm, einige Fenster sind wie eine Schale geformt oder wie Arme, die sich betend zum Himmel richten. Uns wird vieles geschenkt, wofür wir nichts tun müssen: Das Leben, der Atem, Menschen, die für uns da sind. Wir sind zuerst Empfangende. Davon leben wir und davon lebt unser Glaube. Gott sei Dank.
